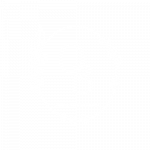Ausgewählte Ausstellungsartikeln
Die Einführungsrede zur Ausstellung von Christoph Woloszyn und Sascha Tamm
Liebe Frau Canales, liebe Künstler, liebe Gäste,
im Namen der Galerie „Kunst in der City“ heiße ich Sie zu der heutigen Vernissage hier in Gelsenkirchen herzlich willkommen.
Die Werke von Christoph Woloszyn und Sascha Thamm stehen im Zentrum dieser Ausstellung. Die Künstler arbeiten in unterschiedlichen Gattungen und präsentieren dementsprechend zwei unterschiedliche Positionen – technisch wie thematisch.
Lassen Sie mich einige Worte zu diesen Künstlern und ihren Werken sagen:
- W. würde im Jahre 1959 in Polen geboren und lebt seit 1987 in Hagen. Seit 1991 wendet er sich der realistischen Malerei zu. Im Jahre 1994 wird sein realistisches Werk zum ersten Mal in Hagen präsentiert. Im Laufe der Zeit entwickelt Woloszyn eine Faszination für das Fotografieren. Dieser Technik, und vor allem der experimentellen Fotografie, widmet er sich intensiv seit inzwischen 6 Jahren.
Seine fotografischen Arbeiten, die Sie in dieser Ausstellung entdecken werden, widmet Woloszyn dem Thema Licht. „Das Licht“, so sagt er, „hat mich immer fasziniert und hier zeige ich die Lichtperspektiven aus meiner Sicht.“
Licht ist, wie Feuer, eines der bedeutendsten Phänomene für alle Kulturen, denn die Hauptquelle des Lichtes auf der Erde ist die Sonne – Energie für das Leben und, in der biblischen Schöpfungsgeschichte, ist Licht das erste Werk Gottes.
Die Photografie, eine wissenschaftliche Erfindung der frühen Moderne, hat die Erkenntnis und das Erlebnis der Welt durch die Menschen grundsätzlich verändert Die Aufnahme einer Zeitbeschränkter und visuell wahrnehmbaren Realität durch die Immaterialität des Lichtes, wirkt bis heute wie ein Wunder, denn sie erlaubt, eine illusorische Wirklichkeit zu erschaffen, die sehr glaubwürdig sein kann. Die fotografisch entstandene Zeit – Raum – Situation wirkt wie ein Spiegelbild der realen Welt.[1]
- W.s Arbeiten lehnen sich an die Merkmale des Surrealismus an: auf diese Weise verschiebt der Künstler die gewohnte Wahrnehmung der vermittelten Inhalte. Das Objekt, in unserem Fall das Licht, wird in einem ungewöhnlichen Kontext dargestellt. Die Erfassung von Stimmungen und Momenten während der Aufnahme des Lichtbildes laden uns auf eine Traumreise in das Unerforschte ein. „Unsere Träume haben eine bilderreiche Sprache, es sind die Bilder der farbenfrohen Welt“. “ – sagt der Psychologe und Traumforscher C. G. Jung.
- W. sagt dazu: „In meinen Gedanken reise ich in die anderen Welten, ich mache einen Zeitsprung in eine fremde Dimension. Da treffe ich das Licht und die Lichter, die verschiedene Formen annehmen und dadurch bedrohlich und gleichzeitig faszinierend wirken.“ So übernimmt C. W. die Ästhetik seiner Zeit, indem er mithilfe der experimentellen Photografie für unsere visuelle Wahrnehmung eine virtuelle Realität schafft, die Teil der modernen Lebenssprache –einer lingua universalis – geworden ist.
- W. beschreibt Licht als „Pure Energie, die nicht gefasst werden kann“. Diese wirkt wie ein Symbol, dessen kosmische Dimension durch seine physikalische Präsenz betont wird. Der Künstler lädt Sie ein, meine lieben Gäste, gemeinsam eine solche Traumreise zu wagen. Die Bilder der Lichter bleiben nun als Erinnerung von diesem Traum.
Die Verselbständigung der Photografie führt zur einer neuen Beziehung zur Malerei: Photograph und Maler entdecken die unbeschränkten Möglichkeiten der Kunstsprache und bieten im Bereich der visuellen Kommunikation unerwartete Wege an.
Kommen wir nun zum zweiten Künstler dieser Ausstellung. Sascha Thamm wurde 1973 geboren, er lebt und arbeitet in Remscheid. Der Künstler bezeichnet sich selbst als „Fischfreak“, der seit frühster Kindheit eine Leidenschaft für Fische und die Darstellung dieser malerisch und zeichnerisch pflegt.
Die Darstellungen eines Fisches sind schon in der alten ägyptischen Kunst zu entdecken. In der frühchristlichen Zeit sind Fische ein verbreitetes Bildmotiv in der Katakomben – Malerei. Während der Renaissance war Fisch der wesentliche Bestandteil des Vanitas – Stilllebens und in der holländischen Malerei der Utrechter Caravadgisten trifft der Fisch als Sinnbild für eine prachtvolle Speise. Auch in den modernen Zeiten ist das Fischsymbol auf Autos oder anderen Gegenständen des alltäglichen Lebens zu sehen.
Nun, warum gewinnt der Fisch so viel an Aufmerksamkeit?
Die Vorstellung, dass sich alles Leben aus dem Wasser entwickelt hat, ist sehr weit verbreitet, sie entspricht auch der heutigen Evolutionstheorie. Von daher symbolisieren Fische zeitweilig verfügbare spirituelle Macht. Sie sind das Sinnbild des Wassers, des Lebens.
Der Fisch war schon in vorchristlicher Zeit ein Glücks-, Heils- und Lebenszeichen. Und die Speisung des Volkes durch Fisch und Brot war als Hinweis auf das Abendmahlssakrament anzusehen. In den Märchen wird vielfach die Symbolik des Fisches reflektiert, besonderes, wenn es um den Fisch geht, der alle Wünsche erfüllt. Dem Fisch offenbaren sich die Wünsche, die, wahrscheinlich, niemals zur Wirklichkeit werden können. So wird der Fisch als Symbol der verborgenen Wahrheit gedeutet, denn sogar in der Geschichte vom Fischzug des Petrus erweist sich Jesus damit als Wegweiser zur Wahrheit.
Die Symbolik des Fisches wird auch dafür benutzt, um die menschlichen Eigenschaften auszudrücken, z. B. „sich wohl fühlen wie ein Fisch im Wasser“, „Munter wie ein Fisch sein“ oder „Kalt wie ein Fisch“.
Nach C. G Jung dient Fisch in vielen Kulturen als Fruchtbarkeitssymbol. Außerdem hat er in seinen Untersuchungen entdeckt, dass Fisch ein Archetypus des eigenen Selbst sein kann. In den Träumen begegnet uns der Fisch als Erscheinungsform der Seele und Ausdruck der psychischen Energie.
Nun, wie ordnen wir die Fische von Thamm in diese traditionsreichen Blickweisen ein? Sie werden sehen, meine lieben Gäste, wie der Künstler seine Fische in andere Formen transformiert, zum Beispiel zu einer Gitarre, einem Tänzer, Schmuckstücken usw. Sogar mit Metallstücken präparierte Tiere sind in seinem Werk zu entdecken. So vieldeutig, wie die Symbolik des Fisches sein kann, sind auch die Werke, die Sascha Thamm uns heute präsentiert.
Damit, liebe Gäste, möchte ich Sie jetzt zum näheren Betrachten der Werke dieser beiden Künstler einladen und wünsche Ihnen einen genussvollen Abend.
[1] Vgl. Marc Scheps, Die Kunst der Fotografie, in: Photografie des 20. Jahrhunderts. Museum Ludwig, Köln, Taschen: Köln 1996, S. 4.
Zu der Ausstellung von Sascha Thamm „Fischeinblicke“ in der Galerie „Kunst in der City“, 4.11. – 30.11. 2011.
Die Verselbständigung der Photografie führt zur einer neuen Beziehung zur Malerei: Photograph und Maler entdecken die unbeschränkten Möglichkeiten der Kunstsprache und bieten im Bereich der visuellen Kommunikation unerwartete Wege an.
Der Maler Sascha Thamm wurde 1973 geboren, er lebt und arbeitet in Remscheid. Der Künstler bezeichnet sich selbst als „Fischfreak“, der seit frühster Kindheit eine Leidenschaft für Fische und die Darstellung dieser malerisch und zeichnerisch pflegt.
Die Darstellungen eines Fisches sind schon in der alten Ägyptischen Kunst zu entdecken. In der frühchristlichen Zeit sind Fische ein verbreitetes Bildmotiv in der Katakomben – Malerei. Während der Renaissance war Fisch der wesentliche Bestandteil des Vanitas – Stilllebens und in der holländischen Malerei der Utrechter Caravadggisten trifft der Fisch als Sinnbild für eine prachtvolle Speise. Auch in den modernen Zeiten ist das Fischsymbol auf Autos oder anderen Gegenständen des alltäglichen Lebens zu sehen.
Nun, warum gewinnt der Fisch so viel an Aufmerksamkeit?
Die Vorstellung, dass sich alles Leben aus dem Wasser entwickelt hat, ist sehr weit verbreitet, sie entspricht auch der heutigen Evolutionstheorie. Von daher symbolisieren Fische zeitweilig verfügbare spirituelle Macht. Sie sind das Sinnbild des Wassers, des Lebens.
Der Fisch war schon in vorchristlicher Zeit ein Glücks-, Heils- und Lebenszeichen. Und die Speisung des Volkes durch Fisch und Brot war als Hinweis auf das Abendmahlssakrament anzusehen. In den Märchen wird vielfach die Symbolik des Fisches reflektiert, besonderes, wenn es um den Fisch geht, der alle Wünsche erfüllt. Dem Fisch offenbaren sich die Wünsche, die, wahrscheinlich, niemals zur Wirklichkeit werden können. So wird der Fisch als Symbol der verborgenen Wahrheit gedeutet, denn sogar in der Geschichte vom Fischzug des Petrus erweist sich Jesus damit als Wegweiser zur Wahrheit.
Die Symbolik des Fisches wird auch dafür benutzt, um die menschlichen Eigenschaften auszudrücken, z. B. „sich wohl fühlen wie ein Fisch im Wasser“, „Munter wie ein Fisch sein“ oder „Kalt wie ein Fisch“.
Carl Gustav Jung hat er in seinen Untersuchungen entdeckt, dass Fisch ein Archetypus des eigenen Selbst sein kann. In den Träumen begegnet uns der Fisch als Erscheinungsform der Seele und Ausdruck der psychischen Energie.
Nun, wie kann man die Fische von Thamm in diese vielfältigen Blickweisen einordnen? Der Künstler transformiert seine Fische in andere Formen, zum Beispiel zu einer Gitarre, einem Tänzer, Schmuckstücken usw. Sogar mit Metallstücken präparierte Tiere sind in seinem Werk zu entdecken. Außerdem widmet Thamm einige Seine Werke den Situationen des politischen und sozialen Lebens, sei es die Ölkatastrophe in Mexico oder die Europakrise. So vieldeutig, wie die Symbolik des Fisches sein kann, sind auch die Werke von Sascha Thamm.
Zu der Ausstellung von Christoph Woloszyn „Lichtperspektiven“ in der Galerie „Kunst in der City“, 4.11. – 30.11. 2011.
Christoph Woloszyn würde im Jahre 1959 in Polen geboren und lebt seit 1987 in Hagen. Seit 1991 wendet er sich der realistischen Malerei zu. Im Jahre 1994 wird sein realistisches Werk zum ersten Mal in Hagen präsentiert. Im Laufe der Zeit entwickelt Woloszyn eine Faszination für das Fotografieren. Dieser Technik, und vor allem der experimentellen Fotografie, widmet er sich intensiv seit inzwischen 6 Jahren.
Seine fotografischen Arbeiten, die Sie in dieser Ausstellung entdecken werden, widmet Woloszyn dem Thema Licht. „Das Licht“, so sagt er, „hat mich immer fasziniert und hier zeige ich die Lichtperspektiven aus meiner Sicht.“
Licht ist, wie Feuer, eines der bedeutendsten Phänomene für alle Kulturen, denn die Hauptquelle des Lichtes auf der Erde ist die Sonne – Energie für das Leben und, in der biblischen Schöpfungsgeschichte, das erste Werk Gottes.
Die Photografie, eine wissenschaftliche Erfindung der Moderne, hat die Erkenntnis und das Erlebnis der Welt durch die Menschen grundsätzlich verändert Die Aufnahme einer Zeitbeschränkten und visuell wahrnehmbaren Realität durch die Immaterialität des Lichtes, wirkt bis heute wie ein Wunder, denn sie erlaubt, eine illusorische Wirklichkeit zu erschaffen, die sehr glaubwürdig sein kann. Die fotografisch entstandene Zeit – Raum – Situation wirkt wie ein Spiegelbild der realen Welt.
Woloszyns Arbeiten lehnen sich an die Merkmale des Surrealismus an: auf diese Weise verschiebt der Künstler die gewohnte Wahrnehmung der vermittelten Inhalte. Das Objekt, in unserem Fall das Licht, wird in einem ungewöhnlichen Kontext dargestellt. Die Erfassung von Stimmungen und Momenten während der Aufnahme des Lichtbildes laden uns auf eine Traumreise in das Unerforschte ein. „Unsere Träume haben eine bilderreiche Sprache, es sind die Bilder der farbenfrohen Welt“. “ – sagt der Psychologe und Traumforscher Carl Gustav Jung.
Woloszyn sagt dazu: „In meinen Gedanken reise ich in die anderen Welten, ich mache einen Zeitsprung in eine fremde Dimension. Da treffe ich das Licht und die Lichter, die verschiedene Formen annehmen und dadurch bedrohlich und gleichzeitig faszinierend wirken.“ So übernimmt C. W. die Ästhetik seiner Zeit, indem er mithilfe der experimentellen Photografie für unsere visuelle Wahrnehmung eine virtuelle Realität schafft, die Teil der modernen Lebenssprache –einer lingua universalis – geworden ist.
Woloszyn beschreibt Licht als „Pure Energie, die nicht gefasst werden kann“. Diese wirkt wie ein Symbol, dessen kosmische Dimension durch seine physikalische Präsenz betont wird. Der Künstler lädt Sie ein, meine lieben Gäste, gemeinsam eine solche Traumreise zu wagen. Die Bilder der Lichter bleiben nun als Erinnerung von diesem Traum.
Essay über die Künstlerin, Autorin und Schauspielerin Wini M.
Liebe Frau Canales, liebe Gäste, liebe Künstler,
hiermit möchte ich euch die Künstlerin, Autorin und Schauspielerin unter dem Namen Wini M. vorstellen.
Wini M wurde in Lünen Westfalen geboren, wo sie zuerst ihre kaufmännische Ausbildung absolviert und viele Jahre in diesem Beruf gearbeitet hat. Seit ihrem 50. Lebensjahr hat sie sich entschieden, ihr Leben der Malerei zu widmen. Außerdem ist sie als Autorin tätig und mit ihren Gedichten und Geschichten in bestimmten Kreisen bekannt geworden. Bis heute lebt sie in Essen und präsentiert sich mit dem eigenen Theater im Ruhrgebiet.
Sowohl in der Kunst, als auch in ihrer Literatur und theatralischen Darstellungen beschäftigt sich Wini M. mit dem Frauenbild und weist damit auf die Geschlechterrollen in der Gesellschaft hin: wer ist eine Frau für den Betrachter? Maria oder Muse, Heilige oder Verführerin? Wie sieht das Leben einer Frau aus, wenn sie sich selbst als Künstlerin, Dichterin oder Theaterdarstellerin positioniert? Und warum ist das Thema der Frau für viele Künstler überhaupt so wichtig?
Dazu möchte ich jetzt an dieser Stelle ein Paar Worte sagen.
„Sie ist fast so schön wie Venus von Milo“ – war die Begeisterung von Picasso zu einer weiblichen Fetischfigur aus Afrika. So stellen wir fest, dass eine Frau immer im Zentrum der Aufmerksamkeit stand. Seit Jahrtausenden beschäftigt sie die menschliche Fantasie und siegelt sich in unterschiedlichen Kunstwerken.
Im Paläolithikum stellten die Frauenfiguren aus Stein, Elfenbein und Tierknochen das erste bekannte Symbol für eine weibliche Fruchtbarkeits- und Muttergöttin dar. Die Idee von der Fruchtbarkeit als lebensinsperierende Kraft verdichtete sich zu einer Symbolfigur – Magna Mater, die lange Zeit die bedeutendste unter den Kultfiguren blieb. Die Darstellung einer Frau als Muttergöttin und Inkarnation der Fruchtbarkeit spielte im alten Ägypten auch wesentliche Rolle: sie wurde als Frau mit Kuhkopf oder mit Kuhhörnern, zwischen denen die Sonnenscheibe prangte, präsentiert. Auch in der kretischen Kunst tauchen immer wieder die Figur der Magna Mater zusammen mit den Darstellungen der Meeresfauna.
Und, wenn wir uns wieder in die heutige Zeit zurückkehren, können wir beobachten, dass ein kleines Kind bei seinen ersten Erfahrungen in der Darstellung von Wirklichkeit das Gesicht der Mutter zeichnet.
Nun, was will uns Wini M. mit ihrem Werk sagen? Die Künstlerin geht moderne Wege in ihrer Frauendarstellungen und verfremdet diese durch Überspitzung und Durchsichtigkeit der Konturen, Benutzung unterschiedlicher Materialien, die als Schmuck und Verkleidung für die weiblichen Figuren dienen. Die Frauenbildnisse scheinen verzerrt, die Körper werden bewusst nachlässig gestaltet. Die benutzen Farben erschaffen eine eigene Komposition und erzeugen das Harmoniegefühl. Die Auswahl der Farben weist auf das Gefühl der Hoffnung hin. Wini M. verbindet in ihren bildnerischen Gestalten die Sprache und setzt das Wort und das Bild in Verbindung. Die Titel der Bilder, wie „Gedicht“ oder „Ohne Worte“ vermitteln poetische Inhalte. So tritt das Bild mit dem Betrachter in einen Dialog.
Osteuropäische jüdische Künstler in Paris (1905 – 1925). Tradition, Variation, Assimilation?
Gibt es eine jüdische Kunst? Man ist gewohnt, diese Frage zu leugnen. Die eigentliche Kunstgeschichte spricht nicht von ihr, sie fehlt in allen Handbüchern. Selbst Israel, das über seine Geschichte, Literatur, Religions- und Kulturgeschichte ganze Bibliotheken geschrieben hat, besitzt eine Kunstliteratur größeren Umfangs nur über die jüdischen Künstler der Gegenwart, die sehr oft unjüdische sind.[1] Kann man aus diesem Grund mit Sicherheit sagen, dass es keinen jüdischen Kunstwillen gab? Aber dass die jüdische Kunst doch immer existierte? Dieses klingt paradox, denn Kunst „kann nicht gewollt, kann auch nicht verboten werden. Sie entsteht mit dem Zelt des Nomaden und dem Krug des Hirten. Sie lebt in jeder Form, die gestaltet wird, sei es zu welchem Zweck auch immer. Denn es ist falsch, unter Kunst nur die Werke persönlichen Schöpferwillens, die Werke der Michelangelo und Raffael, Dürer und Rembrandt zu verstehen. Diese Anschauung entsteht erst mit dem Erwachen des Individualismus, mit der sogen. Renaissance“[2]
Es wird immer erwartet, dass die Kunst eines Volkes ihren eigenen Ausdruck und ihren eigenen Stil habe. In diesem Sinne hat es nie einen jüdischen Stil gegeben, dazu gab es aber immer jüdische Symbole. Besondere Entwicklung bekam die jüdische Illustration als eine Art der jüdischen Kunstsprache. Lubok (Volksprint) galt für die Gestaltung der Manuskripte und wurde zusammen mit der jüdischen Kalligraphie (L’Ornament hébraïque[3]), bspw. von Nathan Altman oder El Lissizky, zum Zeichen der jüdischen Volkskunst. Nun, es bleibt die Frage, was ist die jüdische Kunst? Denn sogar L’Ornament hébraïque enthält orientalische und slawische Motive.
Fünf Millionen Juden haben vor dem 1. Weltkrieg in Russland (Russischen Reich, heute Territorien von Russland, Weißrussland, Ukraine, Litauen) auf dem Gebiet zwischen dem Baltischen und Schwarzen Meer gelebt. Sie besiedelten kleine Städtchen und bildeten Mehrheit der Bevölkerung der russischen Provinzen. Gleichzeitig besaßen sie eigene Religion, Regierungsinstitutionen und Bildungssysteme. Um eigene Identität zu bewahren, sprachen sie hauptsächlich jiddisch. Für die meisten war die Frage der jüdischen Kultur mit der politischen Emanzipation und kulturellen Autonomie untrennbar. Nach der ersten russischen Revolution 1905 – 1907 haben viele Juden ihr Heimatland verlassen und ließen sich in der Hauptstadt Frankreich nieder. Auch später, sogar bis zum Zerfall der Sowjetunion, blieb Paris der wichtige Anlaufpunkt für die Dissidenten aller russischen Regimes. Die Gründe der Emigration nach Paris waren verschieden: es gaben diejenigen, die das Russische Reich aufgrund der politischen Unordnungen infolge der ersten und zweiten Revolutionen bewusst verlassen haben; es gaben auch diejenigen, die Paris als wichtiger Ausbildungsort für sich gesehen haben. Solche lebten mit den Gedanken und Glauben „an die Kunst als den höchsten, sich selbst genügenden Wert.“[4] In dem Sinne war die Hauptstadt Frankreichs für alle geöffnet. Hier durfte sich jeder ausbilden lassen. Es existierten sogar viele russische Gesellschaften und Akademien. Beispiele dafür sind das Literarisch – Künstlerische Gesellschaft, die Freie Schule, die Vasil´eva Akademie, die Russische Akademie / Académie Russe, der Verband russischer Künstler und die Gesellschaft der russischen Künstler in Frankreich. Alexander Benois, der jüdisch – russische Künstler, Gestalter und Kunstkritiker, publizierte in Paris in den Jahren 1904, 1911, 1914 seinen Artikeln in den jüdisch – ukrainischen Zeitschriften und Zeitungen Kiewer Echo oder Kiewer Gedanke über Auftritte der aus Russland und der Ukraine stammenden jüdischen Künstlern in Paris. In der Kiewer Zeitschrift Die Kunst wurde 1912 ein Artikel von Alexandra Exter mit dem Titel Das Neue in der französischen Malerei veröffentlicht, in dem es hauptsächlich über die Kunst der jüdischen Emigranten ging. Viele Künstler waren nicht nur Verfasser der Aufsätze, sondern auch Gestalter dieser Zeitschriften und Zeitungen (z. B. Nathan Altman, Marc Chagall oder Issahar Ryback). Bis zum Ausbruch des 1. Weltkrieges blieben die Vasil´eva Akademie, die Russische Akademie und die zu der Zeit schon existierte Gruppe / Gemeinschaft La Ruche die wichtigsten Zentren des „jungen Russlands in Paris“.[5]
Die La Ruche (dt.: Bienenkorb / Bienenstock) wurde von den Vertretern der École de Paris gebildet. Es war eine Art Kommune oder Wohnheim, wo die Künstler in den Ateliers ohne Gas, Licht und Wasser lebten und arbeiteten.[6] Die Alle bildeten den Mythos des „glücklichen Juden in Paris“[7]. Zu den Vertretern der Gruppe La Ruche gehörten u. a. Chaim Soutine, Mikhaïl Kikoïne, Pinkus Kremegne, Nathan Altman, David Schterenberg, Vadim Meller, Adolf Feder, David Birliuk, Leon Bakst , Vlidimir Baranov – Rossine, die Künstlerinnen Alexandra Exter, Marevna, Sonja Delaunay und viele Andere. Alle Vertreter siedelten in den Vierteln Montparnasse und Montmartre und bildeten die so genannte Pariser Schule oder die École de Paris. Das Klima dieser Schule war spektakulär: es fanden freie Diskussionen statt, hier entstanden die Versuche, einen neuen künstlerischen Stil zu finden.[8]
Die Sammelbezeichnung École de Paris umfasst verschiedene Künstlerinnen und Künstler (darunter meistens Emigranten) die zwischen den beiden Weltkriegen in Paris eine gegenständliche, manchmal expressive, manchmal auch stille und lyrische Malerei verfolgten. Zum Kreis der École de Paris zählen Marc Chagall, Amadeo Modigliani und Chaim Soutine. Im weiteren Sinn bezeichnet dieser Begriff alle Künstler, die in Paris an der Entwicklung der Moderne beteiligt waren. Das sind beispielsweise die Maler des Fauvismus und Kubismus. Allerdings ist diese Bezeichnung ziemlich ungenau. Es steht nur fest, dass mit dem Ausbruch des 2. Weltkrieges der École de Paris das Ende gekommen war.[9] Die anderen Autoren geben eine genauere Bezeichnung der École de Paris. Sie sind der Auffassung, dass zum Unterschied von den anderen als „Schulen“ bezeichneten Kunstzentren der École de Paris kein fixer Stilbegriff zu geben ist. Mit École de Paris wird die Gesamtheit der in Paris lebenden und schaffenden nichtfranzösischen Künstler von der Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts, wie etwa Giorgio de Chirico, Max Ernst, Joan Miró, Pablo Picasso oder Marc Chagall bezeichnet. In russischen Lexika wird im Kontext der École de Paris von einem internationalen Kreis der Künstlerischen Elite in Paris der 1910. – 1920. Jahren gesprochen.[10] Der Terminus École de Paris wurde erst 1925 vom Kunstkritiker André Warnod in seinem Buch Les berceaux de la jeune peinture eingeführt.[11]
In den Diskussionen zum Thema „Geschichte der Russen in Paris“ erklingen sich selten ethnische Motive. So wird die Gruppe von Malern am Montparnasse mal als jüdische Künstler der École de Paris (Soutine, Kikoine, Kremegne, Chagall etc.), mal als ukrainische bzw. belorussische / weißrussische Künstler geführt.[12] Viele von diesen Künstlern wurden später in ihren Heimatländern vergessen, als ob sie überhaupt nie existiert hätten. Viele kamen aus Paris nie wieder zurück, ihre Kunst wurde nur in Frankreich anerkannt. Aus diesem Grund werden sie als französische, seltener als russische, aber fast nie als ukrainische, weißrussische oder jüdische Künstler bezeichnet. Es scheint, dass die Kunst der Juden in Paris die Geburt einer neuen Kunst – der Kunst „eines neuen Geistes, des Geistes der Universalität symbolisiert.“[13]
Literatur:
Avram Kampf, Chagall to Kitaj. Jewish Experience in 20th Century Art, Lund Humphries: London 1990
Beate Reifenscheid (Hrsg.), Treffpunkt Paris! Russlands Künstler zwischen Cézannismus und Lyrischer Abstraktion, Bonn 2003
Cecil Roth, Die Kunst der Juden (Bd. II), Ner-Tamid-Verlag: Frankfurt a. M. 1964
Ernst Cohn – Wiener, Die jüdische Kunst, Gebr. Mann Verlag: Berlin 1995
Markus Stegmann / René Zey, Lexikon der Modernen Kunst, Techniken und Stile, Gruner: Hamburg 2002
Internet:
http://wikipedia.org, URL: http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_de_Paris (05.05.2008)
www.saga.ru, URL: http://www.ssga.ru/erudites_info/art/muzey/text/mo2.html (10.05.2008)
[1] Vgl Ernst Cohn – Wiener, Einleitung. Die Grundfrage, in: ebd., Die jüdische Kunst, Gebr. Mann Verlag: Berlin 1995, S. 1.
[2] Zit. ebd., S. 6.
[3] Vgl. Avram Kampf, One the Quest for a Jewish Style, in: ebd., Chagall to Kitaj. Jewish Experience in 20th Century Art, Lund Humphries: London 1990, S. 17.
[4] Marina Maguidovitch, Schicksale und Karrieren von Künstlern der ‚Ersten Welle’ in Paris, in: Treffpunkt Paris! Russlands Künstler zwischen Cézannismus und Lyrischer Abstraktion (Ausst. Kat., Hrsg. Beate Reifenscheid), Bonn 2003, S. 31.
[5] Vgl. Aleksandra Shatskich, Junges Russland in Paris, in: ebd., S. 10f.
[6] Vgl. Marina Maguidovitch, Schicksale und Karrieren von Künstlern der ‚Ersten Welle’ in Paris, in: ebd., S. 32.
[7] Zit. ebd., S. 32.
[8] Vgl. Cecil Roth, Die Pariser Schule, in: ebd., Die Kunst der Juden (Bd. II), Ner-Tamid-Verlag: Frankfurt a. M. 1964, S. 61f.
[9] Vgl. Markus Stegmann / René Zey, Lexikon der Modernen Kunst, Techniken und Stile, Gruner: Hamburg 2002, S. 38f.
[10] Vgl. digitale Version des Museums der Kunstgeschichte / Muzej Istorii Izobrazitel´nogo Iskusstva, in: www.saga.ru, URL: http://www.ssga.ru/erudites_info/art/muzey/text/mo2.html (10.05.2008).
[11] Vgl. http://wikipedia.org, URL: http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_de_Paris (05.05.2008).
[12] Vgl. Marina Maguidovitch, Schicksale und Karrieren von Künstlern der ‚Ersten Welle’ in Paris, in: Treffpunkt Paris! Russlands Künstler zwischen Cézannismus und Lyrischer Abstraktion (Ausst. Kat., Hrsg. Beate Reifenscheid), Bonn 2003, S. 31.
[13] B. Cecil Roth, Die Pariser Schule, in: ebd., Die Kunst der Juden (Bd. II), Ner-Tamid-Verlag: Frankfurt a. M., 1964, S. 61.
Weiter Publikationen
- [Non]Conform. Russian and Soviet Art. The Ludwig Collection 1958 – 1995, Dr. Barbara M. Thiemann, Olga Breininger, München 2007.
- Bonjour Russland. Französische und russische Meisterwerke von 1870 bis 1925 aus Moskau und St. Petersburg: Pushkin Museum, Tret’yakov Galerie, Ermitage, Russisches Museum, hrsg. vom Museum Kunst Palast, Düsseldorf 2007.
- Jüdische Illustratoren aus Osteuropa in Paris und Berlin, Ausst.-Kat. der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.
- Grafische Kunst der UdSSR, (Katalog zu der Grafischen Sammlung Ludwig, Ludwig Forum, Aachen).
- Illustrationsgrafik der UdSSR, (Katalog zu der Grafischen Sammlung Ludwig, Ludwig Forum, Aachen).
- Zeitpunkte, Heilig Geist Kirche, Oberhausen (Einführung in die Ausstellung, Vortrag)Ziele in weiter Ferne, Galerie Kunst in der City, Gelsenkirchen (Einführung in die Ausstellung, Vortrag)
- Körper – Strukturen – Silhouetten. Werke von Christoph Woloszyn und Jenny Canales, Stadtbücherei Wattenscheid, Bochum (Einführung in die Ausstellung, Vortrag)
- Acht Stimmen, Galerie Kunst in der City, Gelsenkirchen (Einführung in die Ausstellung, Vortrag)
- Frauengestaltungen von Wini M., Galerie Kunst in der City, Gelsenkirchen (Einführung in die Ausstellung, Vortrag)
- Lichtperspektive und Fischeinblicke. Christoph Woloszyn und Sascha Thamm, Galerie Kunst in der City, Gelsenkirchen (Einführung in die Ausstellung, Vortrag)
Kontakt:
Olga Breininger
Email: olgak81@gmx.de